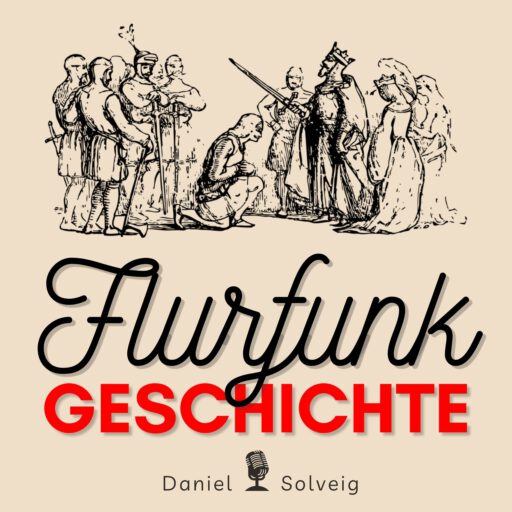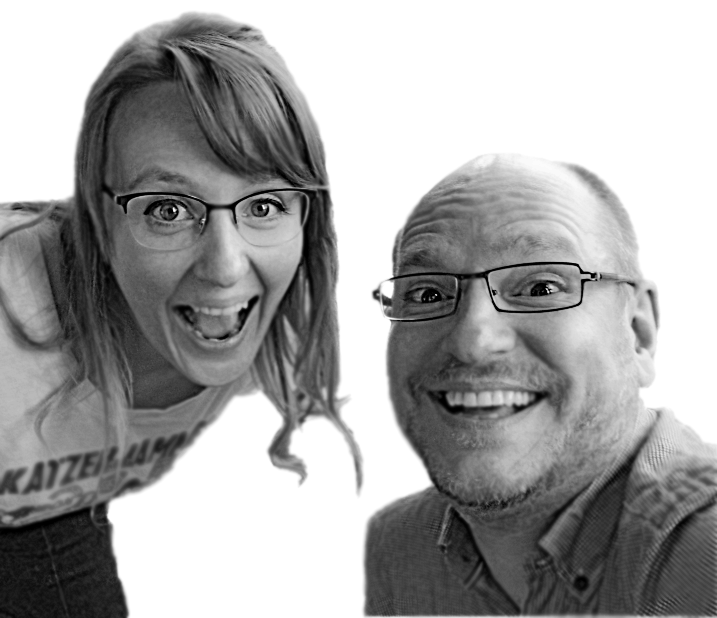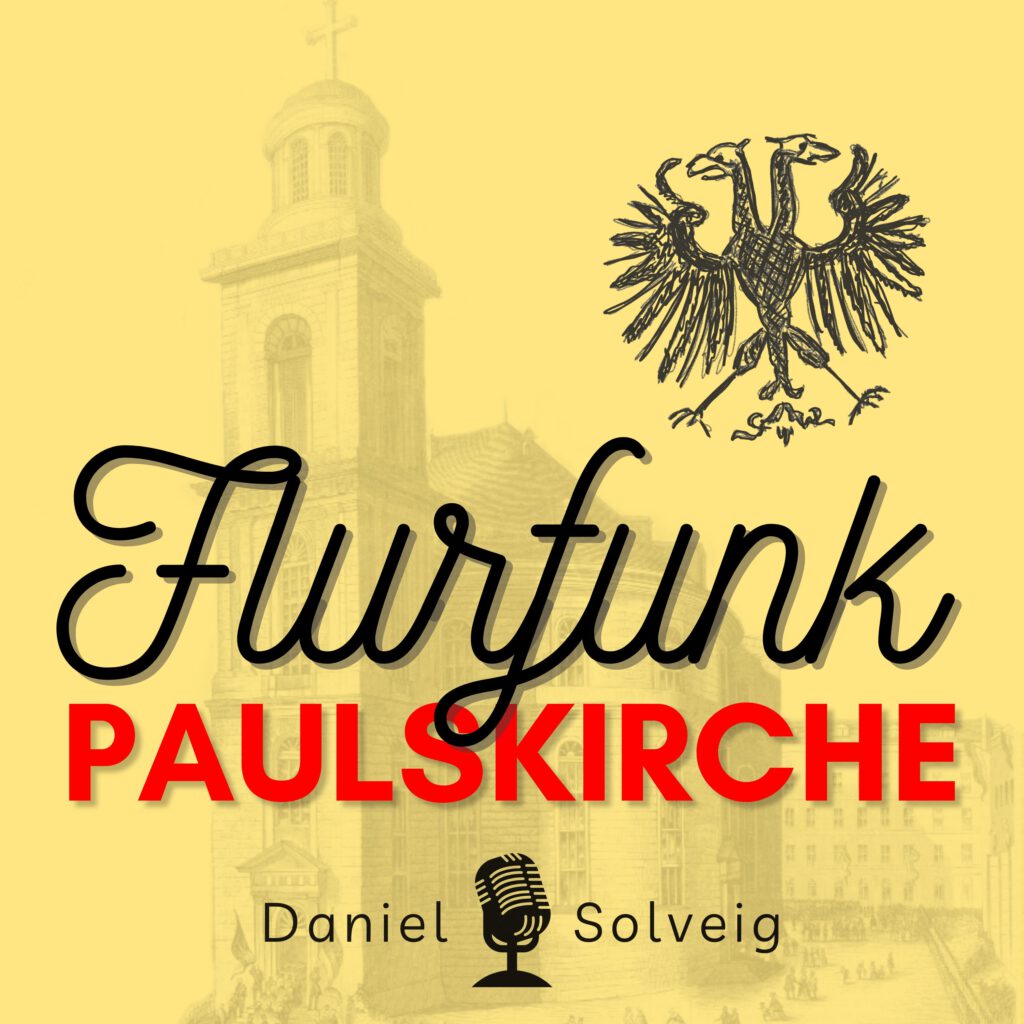61 – Besessenheit und Exorzismus

In dieser Folge setzen wir unser Gespräch über das Böse fort und wenden uns Vorstellungen von Besessenheit und Exorzismus in Bibel, Kirchengeschichte und Gegenwart zu. Ausgangspunkt ist ein gemeinsames Gebet zum heiligen Erzengel Michael, mit dem wir uns symbolisch „rüsten“, bevor wir an unsere vorige Folge über Hölle und Teufel mit Dante Alighieri anschließen. Wir erzählen, was uns an diesem Thema persönlich beschäftigt, binden biblische Texte, alte Riten und neuere Fälle ein und machen immer wieder transparent, wo wir uns selbst schwer tun mit dem Stoff. Gleichzeitig begrüßen wir neue Hörer:innen, verweisen auf unseren Auftritt bei „Alle Zeit der Welt“ und bedanken uns bei allen, die den Podcast unterstützen.
Biblische Dämonenerzählungen und frühe Taufexorzismen
Anhand verschiedener neutestamentlicher Erzählungen über Jesus und „Dämonen“ sprechen wir darüber, wie eng damals Krankheit, gesellschaftliche Ausgrenzung und Besessenheitsvorstellungen miteinander verknüpft sind. Wir erinnern an Geschichten, in denen Dämonen Jesus ansprechen, beim Namen genannt werden und in eine Schweineherde fahren, und überlegen gemeinsam, wie diese Texte funktionieren, ohne sie vorschnell medizinisch oder nur symbolisch „aufzulösen“.
Von dort aus schlagen wir eine Linie in die frühe Kirche: Wir greifen auf Tertullian zurück, der heidnische Götter als Dämonen versteht, und auf Origenes, der die Anrufung des Namens Jesu betont. In den Erzählungen über Antonius den Großen bei Athanasius von Alexandrien werden Kämpfe mit Dämonen Teil eines asketischen Ideals; wir kontrastieren das kurz mit anderen Heiligenbildern.
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Taufexorzismus: Wir lesen Stellen bei Augustinus von Hippo und anderen Quellen, in denen beschrieben wird, wie Taufbewerber:innen durch Gebet, Anhauchen und Ausblasen „gereinigt“ werden, bevor sie getauft werden. Wir zeigen, wie sich diese Praktiken in fränkischen Riten fortsetzen, in denen Wasser, Salz und Öl exorziert werden und ganze Gemeinden in der Fastenzeit in kollektive Exorzismen einbezogen sind.
Der große Exorzismus und das Rituale Romanum
Im nächsten Schritt klären wir, was die Kirche überhaupt unter Exorzismus versteht. Ausgehend vom Codex Iuris Canonici unterscheiden wir zwischen „kleinen“ Taufexorzismen und dem „großen Exorzismus“ über Einzelpersonen, der nur mit bischöflicher Erlaubnis von eigens beauftragten Priestern durchgeführt werden darf. Wir sprechen darüber, dass Exorzismus als sakramentale Handlung verstanden wird, in der die Kirche im Namen Jesu um Befreiung von der Macht des Bösen bittet.
Daran anschließend nehmen wir das Rituale Romanum in den Blick, in dem seit 1614 die maßgeblichen Exorzismusformeln gesammelt sind. Wir lesen längere Ausschnitte aus dem großen Exorzismus und klären den Unterschied zwischen depräkativer Bitte um Gottes Beistand und der imprekativen diekten Ansprache des Dämons. Dabei wird für uns spürbar, wie belastend der Text ist – und gleichzeitig, wie sehr er davon ausgeht, dass die Kirche dem Teufel im Kampf gegenübersteht.
Glaube, Wunder und Aufklärung: Johann Joseph Gaßner
Ausgerechnet im Zeitalter der Aufklärung zieht der Pfarrer Johann Joseph Gaßner als Exorzist und Wunderheiler viel Aufmerksamkeit bekam. Er sah in den meisten Krankheiten Dämonen am Werk und heilte Gläubige durch seinen Segen.. Seine Praxis wird zum Streitfall zwischen Aufklärung, medizinischer Deutung, kirchlicher Kontrolle und volkstümlicher Frömmigkeit – inklusive Konflikten mit Bischöfen und weltlichen Herrschern.
Leoninische Gebete, Konzilsreformen und der Fall Anneliese Michel
Dann wenden wir uns den sogenannten „Leoninischen Gebeten“ nach der Messe zu und der Legende, Papst Leo XIII. habe nach einer Vision das Gebet zum Erzengel Michael formuliert. Wir erzählen, wie diese Gebete im 19. und 20. Jahrhundert im Kontext des politischen Ringens um den Kirchenstaat unter Pius IX. und später neu gedeutet unter Pius XI. stehen – bis hin zu Bezügen zu Russland und Marienerscheinungen.
Im Anschluss sprechen wir über die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils: neue Messordnung, Landessprache, veränderte Kommunionpraxis und die Spannungen zwischen denen, die darin eine Erneuerung sehen, und jenen, die einen Bruch mit der Tradition wahrnehmen.
Diese Auseinandersetzungen bilden den Hintergrund im Fall Anneliese Michel. Wir erzählen ihre Biografie in groben Linien, sprechen über ihre gesundheitlichen Probleme und ihre intensive Frömmigkeit, über Wallfahrten und vermeintliche Erscheinungen. Wir greifen die Rolle des Jesuiten Adolf Rodewick und des Exorzisten Arnold Renz auf, der den großen Exorzismus nach dem Rituale Romanum durchführte, und schildern die langen Reihen von Exorzismussitzungen. Anneliese Michel starb schließlich infolge extremer Unterernährung, die Exhumierung, die Gerichtsprozesse und die Fragen nach Verantwortung, Seelsorge und Krankheit, die uns dabei nicht loslassen.
Reformen des Exorzismus und mediale Bilder des Bösen
Im Anschluss schauen wir auf kirchliche und theologische Reaktionen: auf Kommissionen, in denen Bischöfe, Theologen, Ärzt:innen und Psycholog:innen über Kriterien für Exorzismen beraten, und auf die Überarbeitung des Exorzismusritus, die 1999 in einem neuen Buch mündete. Wir erklären, dass darin deprekative Gebete stärker betont werden und die direkte Anrede des Dämons vorsichtiger gehandhabt wird, ohne dass der alte Ritus vollständig verschwindet – ein Spannungsfeld, das innerkirchliche Konflikte auslöst.
Ein großer Befürworter des alten Rituale war Gabriele Amorth. Als Exorzist des Bistums Rom war er Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der Internationalen Vereinigung der Exorzisten. Zum Schluss dieses Blocks geht es um die mediale Verarbeitung: um den Horrorfilm „Der Exorzist“ und den Film „Exorzist des Papstes“ mit Russell Crowe, die auf Amorth Bezug nehmen – und um die Frage, wie sehr solche Bilder unsere Vorstellungen von Teufel und Besessenheit prägen.
Gegenwart, Freikirchen und Luthers Rat
Zum Schluss schlagen wir einen Bogen in die Gegenwart. Wir sprechen darüber, dass Exorzismen nicht nur ein katholisches Thema sind, sondern auch in evangelikalen und pfingstlichen Milieus vorkommen, und erzählen von Freikirchen, die auf TikTok und YouTube Live-Exorzismen zeigen. Luther dagegen befand, dass man den Teufel am besten verspottet und auslacht, weil er Verachtung nicht ertragen kann.
Die Goldene Schindel
Wir sind beim Podcaster-Quiz „Die Goldene Schindel“ dabei! Das ist ein Wettbewerb von unabhängigen Geschichtspodcasts im DACH-Raum. Die erste Folge ist bereits online; die weiteren Termine sind: am 17., 18., 19. sowie am 27. November. Wir sind dabei – am 19. mit Daniel, und am 27. November übernimmt Solveig.
Übertragen wird das Ganze live auf Twitch, auf dem Kanal von Historia Universalis
Zum Ausblick: In zwei Wochen bleiben wir beim Thema und sprechen über den Exorzismus. Wir reden darüber, du stellst einige Stellen vor – vortragen ist erlaubt, anwenden natürlich nicht. Es ist ein anderes Evangelium, anders formuliert – und wir machen dort weiter, wo wir hier aufgehört haben.
Bis dahin hört doch (nochmal) die Folge „Hexen & Antike Magie“ an: Wir waren zu Gast bei „Alle Zeit der Welt“.
Kontakt und Unterstützung
Dir gefällt Flurfunk Geschichte? Wir freuen uns über eine nette Bewertung oder eine Nachricht von dir.
Du kannst uns über ko-fi unterstützen: https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte
Oder auch regelmäßig durch eine Mitgliedschaft auf Steady: https://steady.page/de/flurfunk-geschichte
Für deine regelmäßige Unterstützung bedanken wir uns mit einer Bonus-Folge „Nachklapp“ zum Thema der aktuellen Folge.
Wir freuen uns über Kommentare und Fragen an kontakt@flurfunk-geschichte.de
Flurfunk Geschichte liefert Euch weitere Hintergrundinfos bei Facebook, Instagram, twitter und threads.